»Jemand hat sich aufgehängt,
Direkt nebenan.
Jetzt klingelt das Telefon,
Keiner geht ran.
Die Nachbarn waren froh,
Denn er war immer sehr laut.
Hat ganz selten gekocht,
Aber immer gekaut.«
Die Nachbarn II. So heißt der Song der großartigen Trierer Post-Punk-Band Love A, in dem sie Albtraum und Alltag heutiger Wohnraumkonzepte beschreiben: man kennt sich. Nicht. Gerade in den sowieso schon anonymen Großstädten ist das ein riesiges Problem für unser dort eh schon angeschlagenes Wohlbefinden. Doch warum ist Nachbarschaft in der Stadt so schwer? Und was machen Regina und ihre Nachbarn hier in Freiburg anders?

Wie wichtig Nachbarn sind
Nachbarschaft. Ein Ding, mit dem ich in meinem Leben eigentlich immer Glück hatte. Als Kind sprang ich in den Gärten fast aller Nachbarn herum. Einer dieser Nachbarn wurde schnell mein bester Freund, ein anderer meine erste Liebe, ein dritter mein Geografielehrer. Bis ich auszog und mich im Dschungel der Großstadt auf einmal selbst um die Beziehung zu meinen Hausgenossen kümmern musste. Ergebnis: ein zerrüttetes Verhältnis in der ersten Wohnung, ein besseres-aber-nicht-gutes Verhältnis in der zweiten.
Doch das muss nicht so sein. Ich ziehe nach Freiburg und merke, wie gut eine Nachbarschaft sein kann. Und vor allem, wie gut sie tut. Eng sein. Befreundet sein. Und: zusammen grillen, den Kindern die Haare schneiden, die Abschlussarbeit formatieren, Eier abgeben, Kuchen vorbeibringen – die Traumvorstellung einer Nachbarschaft. Wie funktioniert das? Und warum ist das eigentlich so toll?
Wat sagt denn die Forschung?

Bevor ich jetzt die schweren Geschütze auffahre, muss ich mich wohl kurz erklären. Stichwort soziales Umfeld. Um zu wissen, wie sehr sich das auf alle Lebensbereiche auswirkt, muss man nicht erst in einer Albtraum-Wohnung in Hamburg gelebt haben. Doch seit dieser einschneidenden Erfahrung bin ich nochmal extra sensibilisiert: fand ich ganz Hamburg wirklich nur deswegen kacke? Mutmaßlich ja. Was Nachbarschaft aber wirklich mit uns macht, kann man nicht nur mutmaßen, sondern auch erforschen.
Einer dieser Forschenden ist beispielsweise Sebastian Kurtenbach. Der Sozialwissenschaftler interessiert sich für die Einflüsse des Milieus auf unser Verhalten und wie sich Nachbarschaft generell beschreiben lässt. Den heutigen Status Quo typisiert er gegenüber der Zeit als »man kennt sich, man grüßt sich«. Nicht mehr, nicht weniger. Meistens bleiben wir für uns. Wir bleiben anonym.
Das habe seiner Meinung nach aber relativ wenig mit dem zu tun, wie es sich der Großteil von uns eigentlich wünscht. Die Traumvorstellung einer Nachbarschaft gleicht nämlich eher einem freundschaftlichen Verhältnis. So, wie ich es eben bei Regina finde: Gemeinschaft, statt jeder für sich. Dieses Idealbild entstamme laut Kurtenbach den Arbeitervierteln der 50er- und 60er-Jahre. Man kennt sich. Man hilft sich. Damals gab es keine großen Unterschiede. Aber ein großes gemeinsames Ziel: den Aufschwung.
Die Philosophie des Geldes
Unterschiede haben wir heute deutlich mehr. Und gemeinsame Ziele? Eher weniger. Ist das also der Knackpunkt? Sind wir zu ungleich? Vielleicht. Probieren wir, dem Ganze mal einen theoretischen Rahmen zu geben.
In Städten leben die verschiedensten Menschen gegensätzlichster sozialer Herkunft und kulturellem Hintergrund. Wir haben die unterschiedlichsten Berufe, Probleme und Hobbys. Georg Simmel, eine in Deutschland eher unbekannte Koryphäe der Sozialwissenschaft des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, nennt das in seinem Werk »Die Philosophie des Geldes« Soziale Differenzierung. Und sagt, dass die in der Stadt höher ist, als auf dem Land. Der Landmensch ist ein Allrounder. Der Stadtmensch hingegen in Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen sehr auf eine Spate spezialisiert. Was das mit Nachbarschaft zu tun hat? Ein Beispiel.
Der Landmensch
Auf dem Land sind die Ressourcen knapper – der oder die nächste Klempner:in ist oft weit weg oder gerade schon ausgebucht. Deshalb müssen wir selbst mehr können. Müssen breiter aufgestellt sein. Da wir aber am Ende nicht alles können, müssen wir uns mit den Menschen verstehen, die uns mit unseren fehlenden Fähigkeiten ergänzen. Und die nah sind: die Nachbarn. Wir helfen uns gegenseitig aus. Ich repariere dein Klo und habe dadurch etwas bei dir gut. Wir schreiben Punkte auf unser imaginäres Tauschkonto. Dafür passt du beim nächsten Mal auf meine Kinder auf.
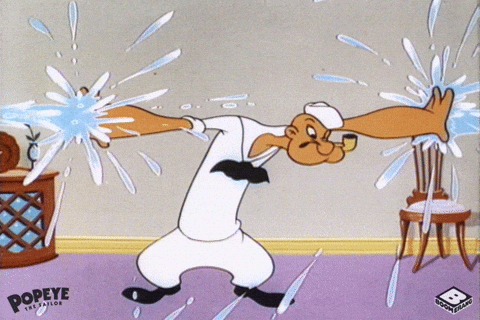
Ob nun ein Mal Klo reparieren genau so viel Wert ist, wie zwei Stunden auf Kinder aufpassen? Das weiß niemand. Und berechnen kann man’s auch nicht. Um das vom Menschen stets angestrebte Gefühl nach Gleichgewicht zu erlangen, tun wir uns deshalb permanent gegenseitig Gefallen. Simmel nennt das den sozialen Tausch. Und der ist gut, weil er den Zusammenhalt stärkt und die Gemeinschaft fördert.
Der Stadtmensch
In der Stadt sieht das Ganze nun so aus. Es gibt erstens viel mehr Ressourcen und zweitens viel mehr verschiedene Arbeit. Es sind nicht nur Haus und Hof zu pflegen, sondern auf einmal muss noch jemand die Bahn fahren, ein Café bewirtschaften und an Nachbarschaft forschen. Nach dem Effizienzprinzip der Arbeitsteilung differenzieren wir uns aus. Das heißt, es gibt viel mehr Leute, die eine Sache richtig gut können. Und dafür viel mehr Sachen, die die meisten Leute gar nicht können. Klo reparieren beispielsweise.
Und weil es so viele Aufgaben gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine:r unserer Nachbar:innen ein Klo reparieren kann, auch ziemlich gering. Bei Allen rumfragen dauert außerdem sehr lange. Und der Stadtmensch ist effizient. Also lassen wir jemanden kommen, der oder die das besonders gut kann. Mit sozialem Tausch kommen wir hier aber nicht weiter. So viele Kinder hat ja die Klempnerin auch gar nicht, als dass alle Menschen, dessen Klo sie repariert, auf diese aufpassen können. Also: bezahlen wir sie. Wir treten mit ihr, nach Simmel, in den ökonomischen Tausch.
Und nun kommt Geld ins Spiel
Plot-Twist. Sobald ich eine Person dafür bezahle, dass sie mir mit meinem Klo hilft, habe ich keine Punkte auf irgendeinem imaginären Konto gutzumachen. Denn ich messe ihrer Dienstleistung einen exakten Wert zu. Und sobald ich sie bezahle, ist das imaginäre Konto glatt auf null. Wir sind quitt. Ich werde dieser Person weder beim Umzug helfen, noch auf ihre Kinder aufpassen. Ich gebe ihr ja Geld. Und mit genau diesem Geld kann sie zum Umzugsunternehmen oder zu einer Babysitterin latschen. Eigentlich ganz praktisch, oder? Schnell, effizient und, na ja, theoretisch auch fair.
Nur eins bleibt eben auf der Strecke: der soziale Tausch. Und damit der Zusammenhalt und die Gemeinschaft.

Tja. Und die fehlenden Kontakte tun uns, wer hätte das gedacht, nicht gut. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Auf Interaktionen sind wir angewiesen. Nicht nur brauchen wir das Gegenüber, um uns validiert zu fühlen. Sondern auch um uns selbst zu erkennen. Um in den Dialog zu treten. Gibt es keinen Dialog, werden wir im besten Fall einsam. Im schlimmsten Fall isolieren wir uns und werden krank. Das Risiko, an Schizophrenie zu erkranken, ist für Stadtmenschen je nach Studie 50 bis 300 (!) Prozent höher, als das Landmenschen. Auch Depressionen oder Angststörungen träten demnach häufiger auf.
Freiburger Nachbarn
Davon sind in der Freiburger Hausgemeinschaft gottseidank alle ziemlich weit entfernt. Hier ist man verbunden. Es gibt drei Geschwister, die drei der acht Wohnungen mieten. Der Mann einer der Schwestern ist ein alter Freund von Regina. Und gegenüber ist ganz frisch Reginas Freundin Ines eingezogen. Man kennt sich. Gut.
Und so kommt es, dass Ines regelmäßig zum Puzzlen, Rätseln und 5-Senses-of-Love-Gucken rüberkommt. So kommt es, dass wir an meinem letzten Wochenende alle zusammen Grillen, mit Abstand versteht sich. Alle bringen was mit, die Kinder spielen im Garten. Regina beglückt uns mit ihren begnadeten Seelen, die sie, wo sonst, bei Ines im Ofen bäckt. Später sitzen wir am Lagerfeuer, aus dem zweiten Stock beschallt uns Pablo mit sanfter Technomusik. Ich unterhalte mich lange mit der 11-jährigen Anaïs über’s Schwester-Sein und mit ihrer Mutter über Berlin. Während ich gleichzeitig mehr als froh bin, im nachbarschaftlichen Garten in Freiburg und nicht in der Isolation der Hauptstadt zu hocken.
Gegen die Einsamkeit

Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn verstärkt das eigene Zugehörigkeitsgefühl. Wir identifizieren uns stärker mit unserem Wohnort. Es reduziert die Einsamkeit, bietet Sicherheit und macht Platz für den ach so wichtigen sozialen Tausch. Denn: wir brauchen soziale Bindungen, um zu überleben. Oder jedenfalls, um nicht abzudrehen. Wir brauchen unsere Nachbarn für den Rückhalt. Und wir brauchen sie, um uns selbst mehr zu Hause zu fühlen. Gerade in Großstädten kann eine gute Nachbarschaft der Schlüssel gegen die immer weiter wachsende Einsamkeitspandemie sein.
Und so gut ich Love A und ihre perfekt-ist-langweilig-Musik auch finde. Aber vielleicht ist es an der Zeit, sich endlich mal bei den unbekannten Nachbarn vorzustellen. Endlich mal Kuchen vorbeizubringen. Oder auf die Kinder aufzupassen. Und dann, wer weiß, auch mal einen Song über eine gute Nachbarschaft zu schreiben. Und vielleicht lauert ja hinter den von außen so bekannten Wohnungstüren eine großartige Freundschaft, eine neue Liebe oder wenigstens ein bisschen Geografie-Nachhilfe.
